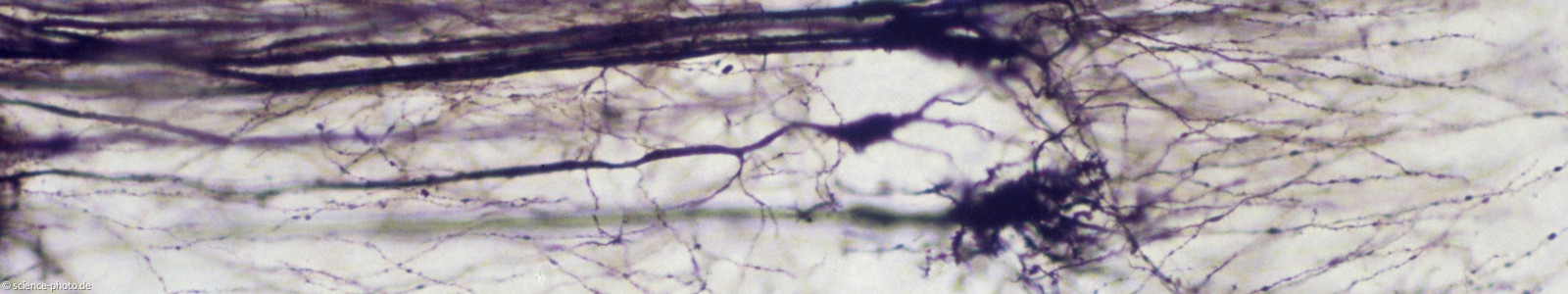Peter Dabrock, Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, spricht sich gerade wegen Fragen der Selbstbestimmung für alternative Wege des Sterbens aus. In seinem Beitrag für "Zeitzeichen" (20.11.2020) schreibt er:
Die palliative Sedierung gibt dem Lassen Raum, sie ermöglicht über den längeren Zeitraum Reversibilität und hält die involvierten Helfenden eher in der Position der Begleitung denn des aktiven Assistierens. Für Ethiken und Praxis- wie Lebensformen, die mit der Rückwirkung von Handlungen auf die je eigene individuelle und kollektive Identitätsbildung rechnen, ist deshalb die Unterscheidung von intentionaler Sterbebeförderung und begleitender Gestaltung des Leben-Lassens von erheblicher Tragweite. Mit der zweiten Alternative, dem freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, wird die grundlegende menschliche Passivität angesichts des Todes geachtet und die lange christliche Kultur des Sterbens als Lassen(-Müssen), auch der ars moriendi als Form des Lassen-Dürfens aufgegriffen und zugleich das – die Neuzeit und Moderne so prägende – Motiv der Selbstbestimmung gewürdigt.
Formen des "natürlichen" Sterbens
Jemand, der schwerkrank auf der Intensivstation liegt und bei der oder dem alle Therapien versagt haben, stirbt nach gängiger Auffassung eines natürlichen Todes. Dabei muss man allerdings im Bewusstsein haben, dass dieser Ort alles andere als natürlich ist, dass die Behandlung eine hochgradig technisch unterstützte ist oder war. "Natürlich" gestorben wäre der Patient genau genommen ohne die Intensivstation und ihre Möglichkeiten, und das meist schon deutlich früher.
Dennoch sehen auch christliche Seelsorgende im Tod auf der Intensivstation keine widernatürliche Art des Sterbens. Die willentliche Beendigung einer Therapie, die vielleicht noch Aussicht auf Lebensverlängerung gebracht hätte, die Verweigerung von Nahrungsaufnahme zur Herbeiführung des Todes oder eben der assistierte Suizid mittels todbringender Medikamente gelten dagegen eher als "wider die Natur".
Wer hat die Deutungsmacht über den eigenen Tod?
Aus christlicher Sicht ist der Tod das vom Schöpfer bestimmte Ende eines Lebens – und der Übertritt in ein Leben nach dem Tode. Der Zeitpunkt des Sterbens ist also gottgegeben und nicht bestimmbar. Diese Sicht ist durch moderne medizinische Möglichkeiten allerdings aufgeweicht. Im Angesicht eines nahenden Todes sind Menschen gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die das restliche Leben und das Sterben beeinflussen.
"Der Tod ist gestaltbar geworden", schreibt Dieter Birnbacher im Buch "Sterben 2.0":
.Der Tod gilt traditionell als eine der großen Kontigenzen des Lebens. Der Tod ist nichts, was der Mensch in seiner Macht hat. Viel eher ist es der Tod, der den Menschen in seiner Macht hat – als die äußerste Grenze seines Lebens. Auch da, wo er nicht – wie gewöhnlich – gefürchtet, sondern ersehnt, mit Ungeduld herbeigewünscht und, wenn er endlich kommt, willkommen geheißen wird, ist er der eigenen Verfügung entzogen, ein Fremder, der seinen eigenen Gesetzen gehorcht. Auch dann, wenn er herbeigesehnt wird, kommt er plötzlich.
Diese Sichtweise des Todes besteht heute weiter, aber sie entspricht zunehmend weniger der Wirklichkeit. Infolge der enormen Fortschritte der medizinischen Möglichkeiten hat der Tod ein neues Gesicht bekommen. Nicht nur den Beginn des Lebens hat die moderne Medizin zunehmend in den Bereich der Verfügbarkeit gerückt, sondern auch das Ende des Lebens. Analog zur Geburtenregelung und -planung ist auch der Tod zunehmend zu einem Gegenstand von Steuerung geworden, hauptsächlich hinsichtlich des Wie des Sterbens, teilweise auch in Bezug auf das Wann. Das Diktum "mors certa, hora incerta" [Der Tod ist gewiss, die Stunde nicht], gilt nur noch mit Einschränkungen.
Ärztinnen und Ärzten wird in der Sterbebegleitung die maßgebliche Rolle zugesprochen. Insbesondere zur Linderung von Leiden ist ihr Fachwissen gefragt, aber auch zur Aufklärung über den Sterbevorgang und Fragen zu Behandlungsweiterführung oder -abbruch.
Im praktischen Alltag ist die Lebensrettung jedoch maßgeblich für Mediziner, Palliativ-Einrichtungen ausgenommen. Das "Sterbenlassen" in einer hochtechnisierten Krankenhausumgebung ist erschwert. Auch das medizinische Personal muss sich – wie der oder die Sterbende selbst – bewusst für das Lebensende entscheiden, auch, wenn es nicht um einen Assistierten Suizid geht, sondern um das Ja oder Nein zur Weiterbehandlung von Patienten, die nach fachlichem Wissen "austherapiert" sind.
Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten haben bei diesem Themenkomplex zur Vereinfachung beigetragen. Ob alle Wünsche aber im Detail der entsprechenden medizinischen Situation bzw. Behandlung entsprechen, ist nicht sicher.
Wann es genug ist
Folgt man dem Selbstbestimmungsrecht, das die Verfassungsrichter in ihrem Urteil so groß schreiben, dann beginnt das Recht auf Sterben schon bei diesen Fragen der Behandlung oder Nicht-Behandlung. Und auch für die Beurteilung des Willens eines oder einer Suizid-Bereiten steht letztlich der Respekt vor dieser Selbstbestimmtheit und der Entscheidung der oder des Betroffenen an erster Stelle: Denn nur selbst kann man fühlen, wann es genug ist.